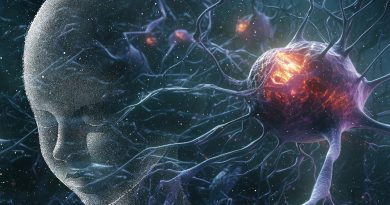Mama, Papa, ich hab so dolle Angst
Wie begegnen wir Kinderängsten?
Angst ist eines der eindrücklichsten Gefühle, das wir Menschen haben. Sie ergreift unseren Körper, unsere Seele und oft auch das soziale System, in dem wir leben. Sie hilft uns zu üben, Gefahren einzuschätzen, vorsichtig zu handeln und wenn nötig Schutz zu suchen, und fordert uns auf, uns weiter zu entwickeln, Lösungen zu finden, um uns an neue Gegebenheiten anzupassen.
In der Entwicklung von Kindern spielt Angst eine große Rolle, weil es immer wieder darum geht, schrittweise selbstständiger und unabhängiger von den Eltern zu werden und neue Bewältigungsstrategien zu aktivieren. Der Übergang von alterstypischer „normaler“ Angst zu einer behandlungsbedürftigen Angststörung ist fließend und hat vor allem mit ihrer Intensität und Dauer zu tun und damit, ob sie der Situation angemessen erscheint. Da Angst aber häufig eher leise daherkommt – im Gegensatz zur Wut, die eher laut ist und sich Raum verschafft – und durch das Einhergehen mit Vermeidung nicht unmittelbar auffällt, bleibt sie oft länger unbemerkt. Und bei weitem nicht jedes Kind (und jeder Erwachsene) mag sie sich eingestehen und beim Namen nennen.
Angst ist in jedem Alter anders
Für jedes Kindesalter gibt es typische Themen, in denen sich Angst zeigt. Während ein Baby vielleicht bei lauten Geräuschen erschreckt und zu weinen beginnt, entsteht im Alter von etwa acht Monaten erwartungsgemäß die Angst vor unbekannten Personen oder fremden Objekten, im Kleinkindalter vor Trennung von vertrauten Bezugspersonen und vor Verletzungen, schließlich auch vor Tieren, vor Dunkelheit, vor phantasierten Gestalten und Monstern. Umso mehr Kinder sich für die Welt interessieren und daran teilhaben, desto vielschichtiger werden ihre Ängste, oft ausgelöst durch Erzählungen oder geteilte Erfahrungen, manchmal auch „nur“ in den Medien. In der Schulzeit können schließlich Ängste vor Prüfungen dazukommen, aber auch soziale Ängste, insbesondere vor Zurückweisung durch Gleichaltrige.
Ängste erkennen
Eltern sind aufgefordert, diese Ängste zu erkennen und einerseits als „sicherer Hafen“ zur Beruhigung zur Verfügung zu stehen und als Ort, um neue Kraft zu tanken. Andererseits ist ihre Weisheit und Stärke gefragt, um aktiv zu ermutigen und bei der Bewältigung von Aufgaben zu unterstützen. Diese beiden unterschiedlichen Rollen erfordern im Laufe der Entwicklung immer wieder eine Überprüfung. Was kann mein Kind schon? Traue ich ihm zu, die Situation zu bewältigen? Kann ich sie ihm heute zumuten? Wieviel Schutz beziehungsweise wieviel Herausforderung ist gerade gefragt? Manchmal bilden sich auch zwischen zwei Eltern unterschiedliche Positionen ab, die sich im Idealfall gegenseitig ergänzen. Während der eine vielleicht lieber behütet und Trost spendet, hat der andere vielleicht Freude zu zeigen, wie attraktiv es sein kann, wenn man sich traut, noch höher zu schaukeln oder ganz nach oben zu klettern ins Baumhaus.
Schwierig wird es, wenn die Begleitung der Angst auslösenden Situation zu einseitig wird, zu mitfühlend oder zu abwehrend. Weder „Das schaffst Du schon – irgendwann“ noch „Stell Dich doch nicht so an!“ ist hilfreich. Nach wissenschaftlichen Erkenntnissen haben ängstliche Eltern ein höheres Risiko, selbst ängstliche Kinder groß zu ziehen, allein durch ihre Vorbildfunktion, aber auch durch die Tendenz zur Überbehütung. Und auch zu viel Druck auszuüben oder gar zu drohen, erhöht die kindliche Anspannung, verbessert aber nicht die notwendige Bereitschaft, sich mit dem unangenehmen Gefühl auseinanderzusetzen.
Angst als Begleiter akzeptieren
Was kann also helfen, das Kind gut zu unterstützen? Zuerst einmal gilt es, die Angst als Begleiter zu akzeptieren und nicht zu ignorieren oder „weg“ haben zu wollen. Umso mehr ich auf die Angst fokussiere und gegen sie ankämpfe, desto mehr Energie wird durch das Nicht-spüren-Wollen gebunden. Daher ist es gut, wenn Eltern eigene Ängste zugeben und sich erinnern, was ihnen selbst als Kind geholfen hat.
Für ein Baby ist es wichtig, dass es verlässlich Aufmerksamkeit erfährt und getröstet wird, wenn es schreit und damit seine Not signalisiert. Es kann sich noch nicht selbst beruhigen und ist darauf angewiesen, dass es von außen reguliert wird. Selbst wenn das Beruhigen nicht sofort gelingt, erlebt es in der Zuwendung durch eine Bezugsperson, dass der Stress wieder nachlässt. Diese Erfahrung stärkt seine Selbstwirksamkeitserwartung, also das Zutrauen, etwas tun zu können, um den eigenen Zustand zu verändern.
Für ein Kleinkind ist es wichtig, die Erfahrung zu machen, dass es tatsächlich selbst etwas tun kann, um weniger Angst zu haben. Es kann den Lieblingsteddy zur Übernachtung bei der Oma mitnehmen oder ein Nachtlicht einschalten, um allein im Bett schlafen zu können. Vielleicht muss vorübergehend auch das Zimmer nach Monstern oder Tierchen abgesucht werden oder ein Zubettgeh-Ritual eingeführt werden, in dem das Kind einen aktiven Part bekommt. Oft hilft Übertreibung und Humor – manchmal braucht es aber einfach Zeit, bis das Kind selbstsicherer wird und auf viele selbstberuhigende Handlungen verzichten kann.
Mit einem Schulkind lohnt es sich, die doofe Angst zu „vermessen“, also auf einer Skala einzuordnen zwischen unangenehm bis vermutlich nicht aushaltbar. Wenn man mit einem mulmigen Gefühl in eine neue Situation gehen muss, kann ein imaginärer Helfer nützen. Das kann ein selbst bemalter Mut-Stein sein oder ein Krafttier, das man in der (Hosen-)Tasche bei sich trägt. Wenn die Angst so groß wird, dass sie in eine komplette Verweigerung mündet, sind hingegen oft viele kleine Schritte und Geduld notwendig, um das Selbstvertrauen nach und nach zu stärken. Wenn das Kind Angst vor der bevorstehenden Klassenfahrt hat, könnte man rechtzeitig üben, erstmal in der Nähe der Eltern an einem fremden Ort zu schlafen und schließlich immer häufiger bei weniger vertrauten Personen, Verwandten oder guten Freunden, zu übernachten. Oft kann es auch helfen, eigene Ziele in Gedanken auszugestalten und sich trotz der Einengung der Möglichkeiten, die die Angst vorzutäuschen vermag, positiv vorstellt, wie man mutig handelt. Umso stärker und eindeutiger meine Motivation ist, mit der Angst fertig zu werden, und umso plastischer ich mir eine Zukunft ohne das Problem vorzustellen vermag, desto mehr Energie kann ich mobilisieren für die erdachte gute Zukunft. Hilfreich ist auch, wenn Eltern neben den ängstlichen Seiten ihres Kindes die mutigen Seiten immer wieder erwähnen und sich in der Familie gegenseitig an Situationen erinnern, in denen es sich überwunden hat und der Spaß die anfängliche Sorge relativierte.
Ängste benennen
Oft fällt es Kindern aber auch schwer, eine eigene Angst zu identifizieren und zu benennen. Gerade nach dem Erleben subjektiver Bedrohung benötigen sie Signale, dass ihr Gegenüber bereit ist, das Erlebte mit ihnen anzuschauen. So können Albträume gemalt werden, um sie besprechbar zu machen. Bilder und Spielsequenzen können ein Versuch sein, die eigenen Erfahrungen in Kontakt zu bringen, zu sortieren, besser zu verstehen und schließlich zu verarbeiten.
Noch mehr als Kinder wünschen Jugendliche sich, in ihren Sorgen ernst genommen zu werden. Wenn sie sich um Krankheit und Tod, Krieg oder Umweltkrisen Gedanken machen, kann es eine entscheidende Erfahrung sein, nicht allein damit zu stehen. Dafür braucht es Zeit und Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu gehen. Denn im Gefühl der Verbundenheit mit anderen finden wir vielleicht am ehesten den Mut, die Unsicherheit einer ungewissen Zukunft zu ertragen, im Wissen, mit anderen gemeinsam nach Lösungen suchen zu können.
Wachsendes Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten hilft
Die ideale kindliche Entwicklungslinie zeichnet sich also weniger durch die Abwesenheit von Angst aus als durch eine gelungene Bewältigung angstmachender Situationen. Mit dem wachsenden Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten wird es leichter, sich in Tapferkeit zu üben. Und gleichzeitig profitieren Kinder und Jugendliche von erwachsenen Bezugspersonen, die authentisch sind, selbst keine Angst vor der Angst haben und bereit sind Orientierung zu geben.
Autorin:
Dr. med. Roxane Burdon,
Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie und Oberärztin in der Tagesklinik für Junges Leben der Vorwerker Diakonie
in Lübeck.